
Zwei schwer beladene Mountainbikes, zwei Wochen Zeit – ein verwegener Plan: Island von Nord nach Süd. Mitten durch die Ódáðahraun, die verrufene Missetäterwüste. In dieser Gegend muss man mit vielem rechnen. Nur nicht, dass es nach Plan läuft.
Der Weg zu den Göttern führt über verbrannte Erde. Ströme von Lava, vor Jahrtausenden ausgekühlt, erstarrt und zerborsten. Eine Landschaft, so trostlos und einsam wie der Mond. Wüst und öde bis zum Horizont. Durchwirbelt von Staub und schwarzem Sand, übersät mit Tuff- und Bimssteinbrocken. Ein paar sandige Hochlandstraßen winden sich lang und umständlich hindurch, oft kaum mehr als eine Fahrspur. Wer auf solchen Wegen vorankommen will, braucht ein wirklich gutes Transportmittel. So wie Odin, der Göttervater, der auf seinem achtbeinigen Pferd Sleipnir schnell wie der Wind durch die nordischen Einöden reitet. Oder der donnergrollende Thor, dessen Streitwagen zwei wundersame Ziegenböcke ziehen. Freyja, die Liebesgöttin, kann sich mit ihrem Falkengewand sogar in die Lüfte erheben. Manchmal nimmt sie auch ihre Katzen ins Gespann oder reitet auf einem streitbaren Eber – Hildisvini, dem Kampfschwein. Und selbst normale Isländer kommen, wenn sie sich auskennen und bei Verstand sind, nur mit außergewöhnlichen Vehikeln in diese Gegend: mit robusten Geländewagen, breit und schwer wie Schützenpanzer. Wir dagegen wollen mit vergleichsweise einfachen Mitteln ins Land der Götter gelangen – mit dem Fahrrad.
Elbsandstein-Touren | Reisereportagen
Das Hochland – mysteriös wie kein zweiter Ort auf Erden
Anfang August 2020: Zwei schwer beladene Mountainbikes, zwei Wochen Zeit – ein verwegener Plan: Einmal Island von Nord nach Süd. Quer durchs Hochland. Thorben und ich. Expeditionsausrüstung, Ersatzteile und genügend Lebensmittel für zwei Wochen fernab von Reparaturwerkstätten und Supermärkten. So beginnt unsere Reise ins windige Landesinnere der Vulkaninsel. Genauer: in den unwirtlichsten Teil davon – die Ódáðahraun, Islands gefürchtete Missetäterwüste. Eine verrufene Gegend voll sagenhafter Geschichten über Ausgestoßene, Schwarzalben, Trolle und anderes finsteres Volk. Jahrhundertelang ein Zufluchtsort für Leute, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten waren. Schwer zugänglich, sandsturmgefährdet und tückisch. Mancher Reisende kehrte nie von dort zurück. Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts verschwanden in den südlichen Ausläufern des Lavafelds, im Gebiet des Askja-Kraters, der Geologe Walther von Knebel und der Maler Max Rudloff spurlos. Eine Steinpyramide erinnert daran. Später, in den 1960er-Jahren, trainierten hier NASA-Teams für die Mondlandung. Und Astronaut Edgar Mitchell (Apollo 14) sagte über die Gegend, sie sei so mysteriös und surreal wie kein zweiter Ort auf Erden. Von der Ringstraße im Norden erstreckt sich das Ödland über weite Teile der aktiven Vulkanzone bis zum Vatnajökull-Gletscher, 5000 Quadratkilometer – ein Gebiet, sechsmal so groß wie Berlin.

Ein Reiseführer ins Land der Sagen
Dass wir ausgerechnet diese Route nehmen, hängt aber mit einem Berg zusammen. Schon aus weiter Ferne sieht man ihn wie eine stolze Festung über der schwarzen Landschaft thronen: den schneebedeckten Herðubreið. Ein gewaltiger Tafelvulkan mitten in der Missetäterwüste, einsam und abweisend mit wolkenverhangenen Flanken und schroffen Wänden aus vulkanischem Glas. 1682 Meter hoch. So groß, dass der komplette New Yorker Central Park anderthalb Mal auf seinem Gipfel Platz hätte. Einheimische nennen ihn die „Königin der Berge Islands“. Für manche ist er aber noch weit mehr als das. Zum Beispiel für Walter Hansen. In seinem mehrfach neu aufgelegten Buch „Asgard“ wies der preisgekrönte Journalist und Schriftsteller Anfang der 90er-Jahre auf erstaunliche Ähnlichkeiten zwischen den geheimnisvollen Welten und Mythenorten der nordischen Göttersagen und bestimmten Naturphänomenen der isländischen Landschaft hin. Manches davon ließe sich sogar wie eine Art Reiseführer in die geistige Welt unserer Vorfahren verstehen. Und ausgerechnet deren wichtigster Schauplatz – daran bestand für Hansen kein Zweifel – befindet sich in der Missetäterwüste: die sagenumwobene Götterburg Asgard. Der Tafelvulkan Herðubreið.

Seit Langem träume ich davon, diesen Berg zu besteigen. Vor Jahren hatte ich schon mal nach Jeeptouren und Möglichkeiten recherchiert, in seine Nähe zu gelangen. Damals sollte es nicht sein. Wir waren zum ersten Mal auf Island. Thorben war noch ein Kind. Manche Träume brauchen einfach ihre Zeit. Und heute – zehn Jahre später – ist mein Sohn schon fast kein Teenager mehr. An raues Wetter und entbehrungsreiche Touren gewöhnt, ruhig auch in kritischen Situationen, belastbar, ausdauernd und zäh. Und wir starten in Nähe des alten Ringwallvulkans Hrossaborg gemeinsam ins Abenteuer: auf der legendären Hochlandpiste F88. Vater und Sohn gegen die Missetäterwüste.

Am nördlichen Rand der nährenden Erde (…) gingen zur Ruhe Unholde und Riesen, Gespenster, Zwerge und Schwarzalfen.
Hrafnagaldr, Ältere Edda
Vorwärts im kleinsten Gang
Freitag, 7. August. Das Wetter meint es gut mit uns. Doch das hat auf Island nichts zu bedeuten. Ein gängiges Sprichwort hier besagt: Gefällt dir das Wetter nicht, so warte nur zehn Minuten, bis es sich ändert. Umgekehrt gilt das dann freilich genauso. Nur auf eines ist Verlass: auf den Wind. Wind ist immer – und er kommt immer aus ein und derselben Richtung: von vorn. Ganz egal, wie du es anstellst, ob du nach Norden, Süden, Osten oder Westen fährst, du hast Gegenwind und als Radfahrer nur die Wahl: Entweder du verzweifelst daran oder freust dich, dass dir beim Abstrampeln wenigstens ordentlich warm wird. Denn das Hochland ist kalt – auch im Hochsommer. Die ersten Kilometer kommen wir gut voran. Der Himmel ist blau, die Sonne lacht, über der Wüste flimmert die Luft. Vor uns liegen nichts als eintönige Schutt- und Geröllfelder soweit das Auge reicht. Wir fahren in den niedrigen Gängen, müssen erst warmwerden mit der ungewohnten Umgebung. Unsere beiden Lastesel rumpeln gemächlich und einträchtig hintereinander her – ein, zwei Stunden geht das so – ohne dass sich irgendetwas ändert. Dann ist der Frieden vorbei. Am Nachmittag treiben von Südwesten plötzlich dunkle Wolken heran. Unvermittelt legt auch der Wind zu, so als wolle er uns zeigen, wozu er fähig ist. Seine Vorhut lässt nicht lange auf sich warten: Staubteufel tanzen über die Ebene, zischen und tollen um uns herum, kreisen uns von allen Seiten ein. Schon bald fegen uns die ersten Sturmböjen um die Ohren, rütteln am Lenker, drücken die Räder aus ihrer Spur. Wir kriegen Sand in die Augen, strampeln uns ab, kommen nur noch mit Mühe vom Fleck und müssen immer öfter absteigen und schieben. Noch ahnen wir nicht, dass das alles nur die Ouvertüre ist…
In Walhalla gibt´s keinen Met
Mit blankem Silber gedeckt ist die Götterburg. Ihre Hallen und Paläste leuchten weithin übers Land, uneinnehmbar sind ihre Mauern. Ganz oben steht ein Turm, von dessen Spitze Allvater Odin die Welten überblickt. Zum einzigen Tor gelangt man von Westen. So ist es in der Edda überliefert, der großen altisländischen Mythendichtung aus dem 13. Jahrhundert. Das alles passt auf den Herðubreið! Schneebedeckt ist er, mit schroffen und – je nach Stand der Sonne – bisweilen dunkel leuchtenden Felswänden aus Hyaloklastit, vulkanischem Glas, wie es infolge rasanter Abkühlung entsteht, durch einen thermischen Schock, wenn z.B. Magma und Eis aufeinandertreffen. Und oben auf dem Gipfel, oft nebelverhangen, sitzt ein Kraterkegel, der das Plateau noch einmal um 150 Meter überragt. Für Bergsteiger interessant ist vor allem die Sache mit dem Tor. Denn nur an einer Stelle, im Nordwesten, sind die senkrechten Wände des Vulkans von einer Schuttrampe durchbrochen. Steil wie ein Kirchendach, extrem steinschlaggefährdet, aber dennoch – eine Aufstiegsmöglichkeit.
Ein Deutscher kletterte 1908 auf diesem Weg als Erster auf den Herðubreið: der Berliner Geologe Hans Reck. Als wir uns anseilen, sind wir bereits 15 Kilometer weit durch die Wüste gewandert. Unser Basislager befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite des Vulkans: die Oase Herðubreiðarlindir. Einer der ganz wenigen grünen Flecken in der Missetäterwüste. Ein kleiner Bach fließt hindurch, es gibt Gras und Butterblumen, Engelswurz und Zwergweiden – sogar eine Zeltwiese mit Toilettenhäuschen. Einziger Nachteil: Um von dort zum Tor der Götterburg zu gelangen, muss man das riesige Bergmassiv zur Hälfte umrunden, was bestenfalls vier Stunden Fußmarsch bedeutet – schlimmstenfalls kommt man gar nicht hin. Tags zuvor hatten wir es bereits vergeblich versucht. An diesem Tag ging in der Wüste ein dermaßen heftiger Wind, dass wir irgendwann nicht mehr dagegen ankamen.
Montag, 10. August. Der Weg nach oben beginnt als sandiger Pfad, von dem schon nach wenigen Serpentinen kaum mehr übrig bleibt als eine Ahnung – noch ein Stück weiter oben verliert er sich gänzlich. Anfangs geht´s noch halbwegs trittsicher die Geröllhalde hinauf, dann beginnt die Schinderei. Unter uns gerät alles ins Rutschen. Steine purzeln zur Seite, die Füße versinken, bald stecken wir bis zu den Knien im Schutt. Nirgendwo ist mehr fester Boden. Als würden wir auf der Stelle treten oder einen Sandberg erklimmen. Einen Schritt hoch, einen halben zurück – manchmal ist es auch umgekehrt. Auf diese Weise müssen wir fast 1000 Meter Höhenunterschied überwinden. Wir klettern und wühlen uns mühsam bergauf, verschnaufen alle paar Meter… Der Hang wird immer steiler, und der Gipfel will nicht näher kommen. Die dünne Reepschnur, die wir uns zur Sicherheit um die Brust gebunden haben, ist kaum mehr als ein psychologischer Halt. Wer hier nicht aufpasst, fährt in einer Lawine aus Staub und Steinen geradewegs in die nordische Unterwelt… Unsere Trinkpausen häufen sich. Die beiden Flaschen und der Wassersack, die ich aus dem Basislager mitgenommen habe, gehen zügig zur Neige. Zum Glück müssen wir an einem großen aufgeweichten Schneebrett vorbei. An einigen Stellen sickern dünne Rinnsale unter ihm hervor, sodass wir wenigstens ein paar Schlucke Schmelzwasser trinken können. Den Fuß drauf zu setzen wagen wir nicht.

… der Hochsitz, der Hlidskialf heißt, und wenn Allvater auf diesem Hochsitz sitzt, so übersieht er die ganze Welt.
Gylfaginning, Jüngere Edda
Dann endlich, am späten Nachmittag – der Gipfel! Wir zwei sind völlig am Ende, ausgepumpt, hingestreckt auf dem erstbesten Felsblock. Vom versprochenen Met, der gefallenen Kriegern in Odins Festsaal Walhalla gereicht wird, bekommen wir nichts zu sehen. Dafür lässt er uns aber einen kurzen Moment lang von seiner Warte auf die Welt blicken – weit in die Ferne, bis ans Ende aller Dinge. Wir haben es genauso vor Augen, wie es die nordischen Mythen beschreiben. Zum Schluss versinkt alles in Schutt und Asche. Das Ende der Welt sieht so aus – wie die Missetäterwüste.
Gefangen im Sandsturm
Donnerstag, 13. August – frühmorgens 4 Uhr. Unser Zelt gebärdet sich wie eine Furie. Die Wände heulen in Sirenenlautstärke, schlagen um sich, hämmern gegens Gestänge, zerren wie wild an ihren Leinen. Das Außenzelt ist zum Zerreißen gespannt – bläht sich auf, fällt zusammen, jammert, knallt und winselt, wieder und wieder. Alle Schnüre singen in den höchsten Tönen. Staubwolken stieben durchs Innenzelt, von draußen werfen uns unsichtbare Plagegeister immer wieder ganze Schaufeln voll Dreck aufs Dach. Manchmal stoßen wir mit den Nasen fast an die Decke – so tief wird sie eingedrückt. Seit Stunden liegen wir in unseren Schlafsäcken wach und bekommen kein Auge zu. Drinnen ist es zu laut zum Schlafen. Draußen geht die Welt unter. Wir sind gefangen – in einem Sandsturm.

Mittlerweile sind wir vom Herðubreið eine Tagesetappe weiter in die Wüste vorgestoßen, bis ins Dyngjufjöllgebirge an den Rand der Askja – Islands größtem Vulkan. Vor Tausenden von Jahren riss hier eine Eruption gewaltigen Ausmaßes einen riesigen Krater in die Landschaft: 45 Quadratkilometer groß. In neuerer Zeit, bei einem zweiten ungeheuerlichen Ausbruch, bildete sich 1875 inmitten der Caldera eine zweite – Heute funkelt darin eine der kostbarsten Perlen des isländischen Tourismus: der blaue Kratersee Öskjuvatn. Man kann Abenteuer-Touren hierher buchen. An schönen Tagen kommt es vor, dass sich ganze Kolonnen von Jeeps eingehüllt in Staubwolken durch die Lavafelder der Missetäterwüste bis zur Askja hinaufwühlen. Fegen Stürme übers Land, kommen keine Touristen.
Der Sandsturm hält uns womöglich auch die Schwarzalben vom Leib, die im Dyngjufjöll hausen sollen. In ihren Höhlen und unterirdischen Gängen kann man sie an der Askja manchmal herumfuhrwerken hören – dann kommt ein Rumpeln, Klopfen und Zischen aus der Erde wie von Hämmern und Blasebälgen. Geräusche einer vulkanischen Schmiedewerkstatt. Walter Hansen beschreibt sie in seinem Buch – wir bekommen sie nicht zu hören. Und das ist auch gut so! Islands Vulkanologen haben ein wachsames Auge auf die Askja. Denn der Vulkan unter dem Dyngjufjöllgebirge ist aktiv und brandgefährlich. 1961 tat sich hier urplötzlich eine 750 Meter lange Feuerspalte auf. Lavafontänen schossen bis zu 400 Meter hoch in den Himmel. Jeden Moment kann es wieder soweit sein. Unser Gefängnis ist kein angenehmes: Über unseren Köpfen tobt der Sturm. Unterm Hintern tickt die Bombe.
Rückzug aus der Wüste
Wir haben viel Zeit verloren! Erst am Herðubreið. Und nun hält uns der Sturm schon zwei Tage an der Askja gefangen – Wir kommen nicht mal aus dem Zelt heraus. Erst in der dritten Nacht flaut er allmählich ab. Vorbei ist die Gefahr noch nicht. Draußen durch die Wüste treiben immer noch Sandwolken. Die Landschaft verzischt hinter blassgelben Schleiern. Auch der Himmel sieht noch bedrohlich aus – finster und violett. Womöglich hätten wir den Göttern nach unserem Gipfelsieg zuerst ein Opfer darbringen müssen. Nun ist es dafür zu spät. Unser Zelt ist kaum noch von der Umgebung zu unterscheiden. Im Vorzelt liegen haufenweise Sand und Steine herum. Und auf allen Sachen klebt eine dicke bimssteinfarbene Patina, die sich nur schwer wieder abkratzen lässt.

Wir machen Bestandsaufnahme: Unsere Lebensmittelreserven werden nicht mehr für die Traverse bis in den Süden reichen. Die Räder sind in Ordnung – aber zu schwer beladen. Vor allem kommen wir gegen den Wind und auf den sandigen Pisten viel langsamer vorwärts als gedacht. Dadurch werden auch die Durststrecken länger, auf denen es kein Wasser gibt. Die Ranger auf der Hochlandhütte am Dyngjufjöll warnen uns eindringlich davor weiterzufahren: Das richtig dicke Ende komme erst in den Sandern südlich der Askja. Dort sind sogar schon Jeeps stecken geblieben. „Mit euren Rädern wird das ein elender Kampf“, sagt einer.
Sonntag, 16. August. Wir kehren um. Nach Norden, wo wir hergekommen sind – allerdings auf einem anderen Weg: Über die Hochlandpiste F 910 und die Gletscherflüsse des Vatnajökull am östlichen Rand der Missetäterwüste. Das schöne Wetter ist zurück. Die Wüste glänzt in der Sonne. In Abermillionen Kieseln und Körnern funkelt das Licht. Auch der Himmel strahlt über beide Backen, nur ein paar federleichte Zirruswolken garnieren den südlichen Horizont. Ausnahmsweise geht kein Wind! Nicht mal ein Lüftchen. Ein Tag, an dem jedem leidgeprüften Island-Biker das Herz lacht. Ein Tag für die Götter…
Nicht so für uns! Denn die F 910 übertrifft unsere schlimmsten Befürchtungen. Zuerst wird die Piste schwierig. Dann kommt der Durst. Und daraus wird „ein elender Kampf“. Schon nach wenigen Hundert Metern beginnt die Straßenhölle. Sand! Knöcheltief. Die Fahrspuren sind stellenweise zugeweht. Kein Durchkommen mehr. Die Räder fangen an zu schwimmen, graben sich ein, geraten ins Stocken, stellen sich quer, machen was sie wollen – bis nichts mehr geht. Ein ums andere Mal müssen wir absteigen und schieben. Kilometerweit. Stundenlang. Die schweren Bikes lassen sich im Treibsand kaum von der Stelle bewegen. Nach fünf Schritten wird der Atem schwer. Nach fünf Minuten pfeift die Lunge auf dem letzten Loch. Jeepfahrer feuern uns im Vorbeifahren mit hochgerecktem Daumen an. Wir hingegen fluchen und spucken den Staub aus, den sie uns ins Gesicht blasen. Die Strapazen wollen kein Ende nehmen. Nur der Durst treibt uns vorwärts. In zwölf Stunden schaffen wir zwei ganze Tagesetappen – einfach, weil wir es müssen. Weil uns sonst das Wasser ausgeht. Kurz vor Mitternacht erreichen wir endlich den Bach aus dem Álftadalur. Wir schlagen das Zelt auf und trinken uns satt. Morgen sind wir aus der Wüste raus. Den Göttern sei Dank!

Sein Schicksal kenne keiner voraus, so bleibt der Sinn ihm sorgenfrei.
Havamal, Ältere Edda
Epilog: Ein seltsamer Traum
Donnerstag, 20. August. Bakkagerði, ein Dorf in den Ostfjorden. Gestern Nacht hatte ich einen seltsamen Traum: Ein Mann war darin erschienen – überlebensgroß, dunkel und schemenhaft. Auf dem Kopf trug er einen Hut mit breiter Krempe. Sein eines Auge leuchtete himmelblau wie ein Topas, das andere konnte ich nicht sehen. Sein Bart war kraus und schwarz und ging ihm bis auf die Brust runter. Er trat auf mich zu, gab mir ein Geldstück und deutete auf meine Stirn. Dorthin sollte ich die Münze stecken.
Dieser Traum lässt mir keine Ruhe. Was hat er zu bedeuten? Münzen symbolisieren etwas Erstrebenswertes: Wohlstand und Glück. Andererseits sind Glück und Wohlstand beides vergängliche Güter, der Traum könnte also auch ihr genaues Gegenteil bedeuten. Vielleicht haben wir in der Missetäterwüste etwas Wertvolles gewonnen. Vielleicht auch etwas verloren: Unser ursprüngliches Ziel, nach Süden zu kommen. Oder die Zeit der Kindheit, als mein Sohn noch klein war. Sein Sandkasten ist größer geworden. Ihm gehört eine ganze Wüste.




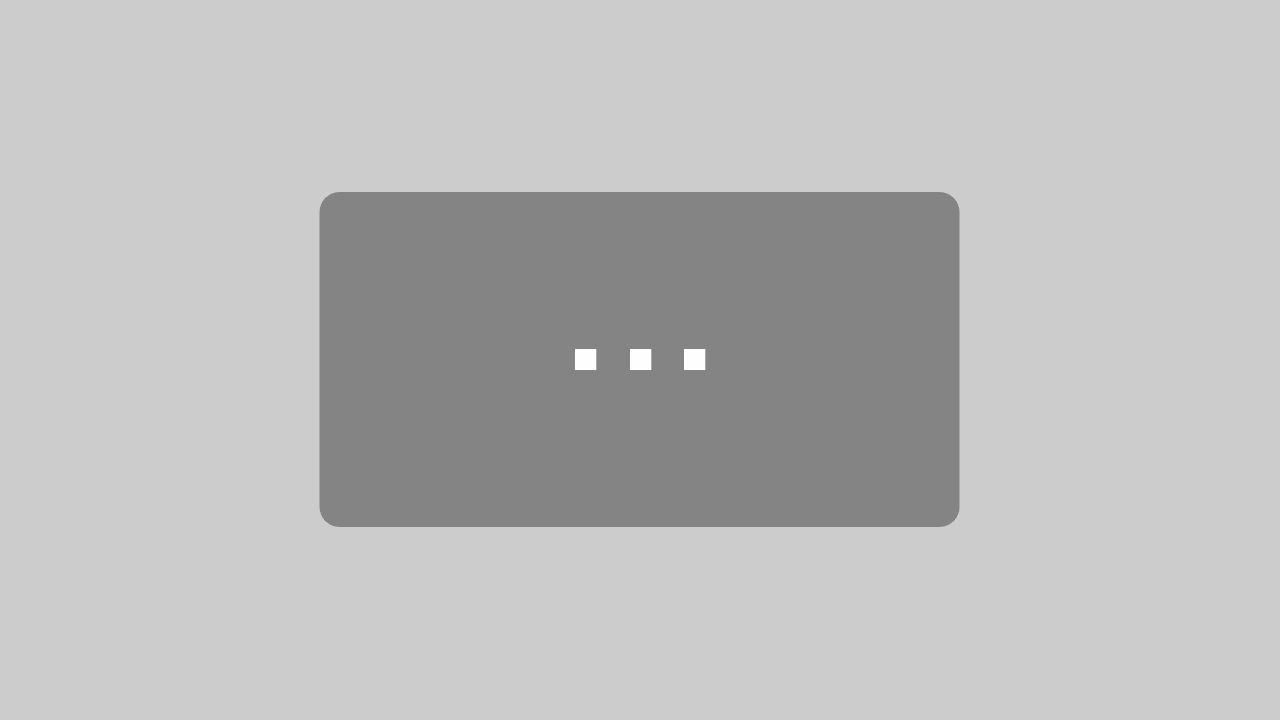


















Kommentar hinterlassen